Für Eilige: Alles Wichtige auf einen Blick
Artikel-Highlights
SMART Ziele formulieren: Ist das nicht ein alter Hut? Kennt doch jeder! Wird in jedem Seminar und jeder Weiterbildung durchgekaut. Mittlerweile ist die SMART-Formel über 40 Jahre alt und definitiv die bekannteste Methode zur Zielformulierung.
Komisch ist nur, dass trotzdem so viele Fehler bei der Formulierung von Zielen gemacht werden. Also ist es ja scheinbar doch nicht so einfach, oder? Es kann nicht häufig genug betont werden, wie wichtig konkrete und messbar formulierte Ziele sind – besonders im Projektmanagement.
In diesem Artikel erfährst du, was SMARTe Ziele sind und wie du die SMART-Formel dazu einsetzen kannst, präzise und robuste Projektziele zu formulieren.
SMARTe Ziele einfach erklärt
SMART ist ein Akronym, das als Hilfsmittel zur Formulierung präziser Ziele eingesetzt wird. Jeder der Buchstaben steht für ein Kriterium, das die Zielformulierung erfüllen soll. Im deutschen Sprachraum stehen die Buchstaben am häufigsten für folgende Begriffe:
- S: Spezifisch
- M: Messbar
- A: Akzeptiert
- R: Realistisch
- T: Terminiert
Die folgende Tabelle zeigt eine Übersicht über alternative Begriffe im Deutschen und Englischen, die häufig genutzt werden:
| Deutsch | Englisch | |
|---|---|---|
| S | Spezifisch | Specific, Simple, Sensible, Significant |
| M | Messbar | Measurable, Meaningful, Motivating, Manageable |
| A | Akzeptiert, Attraktiv, Aktivierend, Angemessen, Ambitioniert, Aktiv, Ausführbar | Achievable, Assignable, Agreed, Attainable, Aligned, Ambitious, Appropriate |
| R | Realistisch, Realisierbar | Reasonable, Realistic, Relevant, Result-based |
| T | Terminiert | Time-related, Time-bound, Timely, Time-based, Time-sensitive, Trackable |
Kostenloses Online-Tool
Du hast Lust, mal selbst auszuprobieren? So funktioniert’s:
- Gib eines deiner Ziele in das Feld unten ein.
- Drücke ENTER
- Es kann einen Moment dauern, bis das Ergebnis angezeigt wird.
Die Geschichte der SMART-Methode
Die Idee hinter SMARTen Zielen steckt im Konzept Management by Objectives von Management-Papst Peter Drucker. Ein gewisser George T. Doran hat schießlich 1981 einen Artikel über Zielsetzungen im Management veröffentlicht und SMART erstmals erwähnt: There’s a S.M.A.R.T. way to write management’s goals and objectives In diesem Artikel beschreibt Doran folgende Kriterien für gute Ziele:
- Specific: Werde möglichst konkret!
- Measurable: Gib eine Messgröße an!
- Assignable: Definiere einen Verantwortlichen!
- Realistic: Formuliere realistische Ergebnisse unter Beachtung der vorhandenen Ressourcen!
- Time-related: Gib einen Endtermin an!
Bereits Doran empfiehlt, die Kriterien als eine Art Checkliste zu verwenden. Der Ansatz: Nicht jedes Kriterium muss zwingend formuliert werden, aber du solltest dich zumindest fragen, ob das Kriterium für dein Ziel sinnvoll ist.
Wichtigkeit im Projektmanagement
Warum sind SMARTe Ziele so wichtig? Ganz einfach: Weil häufig Formulierungen als Ziele verkauft werden, die schlichtweg keine Ziele sind. Eher sind es vage Ideen, Wünsche oder eine Auflistung von Aktivitäten, die nur nach außen als Ziele dargestellt werden.
Beispiele gefällig?
Was ist der Nachteil solcher vermeintlicher „Ziele“? Ganz einfach: Sie sind so unkonkret, dass alle Beteiligten sich ein eigenes Bild vom Zielzustand machen können. Das führt zu Missverständnissen und unklaren Erwartungshaltungen.
Spielen wir noch ein weiteres Beispiel durch:
Zugegeben: Dieses Beispiel ist vereinfacht, illustriert aber sehr schön die Auswirkungen unscharf formulierter Ziele. Selbst wenn das Unternehmen sich auf einen „Laufschuh für ambitionierte Wettkampfläufer“ konzentriert hätte, bleiben viele Fragen offen – wie du gleich beim ersten Bestandteil „S“ der SMART-Formel sehen wirst.
SMARTe Ziele richtig formulieren
In den folgenden Abschnitten gehen wir auf die Interpretation der Buchstaben ein, die im deutschen Sprachgebrauch am meisten verbreitet ist.
S – Spezifisch
Formuliere so klar und konkret wie möglich, was du erreichen möchtest. Je genauer du dein Ziel beschreibst, desto leichter kannst du die richtigen Schritte ableiten, die zur Zielerreichung nötig sind. Als Hilfsmittel haben sich die typischen W-Fragen bewährt:
- Wer wird zur Erreichung des Ziels benötigt? Wer sind die Schlüsselpersonen?
- Was genau soll erreicht werden? Welche Ergebnisse werden angestrebt?
- Wann Wann soll das Ziel erreicht worden sein? Zieltermine sind zwar auch im Bereich „T“ (terminierbar) vorgesehen, doch auch hier kannst du schon grobe Zeitangaben nennen.
- Wo soll das Ziel erreicht werden? Auch wenn dieses Kriterium nicht immer relevant ist, solltest du zumindest darüber nachdenken.
- Warum soll das Ziel erreicht werden? Was ist der Nutzen? Die Antwort auf diese Frage hat einen hohen Wert für die Motivation aller Beteiligten.
- Welche Hürden und Hindernisse können auftreten? In einer knappen Zielformulierung findet die Antwort oft keinen Platz – einen Gedanken ist die Frage allemal wert.
Wie bereits oben erwähnt: Nicht alle Antworten müssen zwingend in eine Zielformulierung gequetscht werden. Nutze die Fragen als Checkliste und formuliere das Ziel mit den für dich sinnvollen Kriterien.
Die folgenden Beispiele zeigen, wie Ziele spezifisch formuliert werden können:
Spezifische Ziele sind gut, doch sie haben einen Haken: Woher weißt du, dass das Ziel erreicht wurde? Schauen wir noch einmal auf das Laufschuh-Beispiel:
Genau hier kommt das nächste Kriterium ins Spiel: die Messbarkeit.
M – Messbar
Nenne wenn immer möglich messbare Kriterien, wie Kennzahlen, Mengen oder Einhaltung von speziellen Normen oder Standards. Ungünstige Formulierungen sind “möglichst niedrige Kosten”, “Erhöhung der Qualität” oder “Ausbau des Marktanteiles”. In diesen Formulierungen fehlt ein konkretes, messbares Kriterium.
Wenn du deine Ziele spezifisch und messbar formulierst und damit die beiden ersten Kriterien der SMART-Formel erfüllst, hast du die Löwenarbeit bereits erledigt. Jetzt beginnen wir mit dem Finetuning.
A – Akzeptiert
Das „A“ steht nicht nur für „akzeptiert“, sondern auch für „angemessen“ oder „attraktiv“. Alle drei Begriffe zeigen grob in die gleiche Richtung: Solange alle Beteiligten das Ziel als sinnvoll und motivierend wahrnehmen, werden sie an einem Strang ziehen und das Ziel mit einem guten Gefühl verfolgen.
R – Realistisch
Dieses Kriterium hängt eng mit dem vorigen Punkt zusammen: Realistische Ziele werden leichter akzeptiert und motivieren deutlich stärker, als solche, die bereits im Vorfeld als unrealistisch angesehen werden. Lässt ein Laufschuh einen Läufer schnell wie ein Auto werden? Wohl kaum! Herausfordernde Ziele sind okay, unrealistische rauben die Motivation und machen unglaubwürdig.
Tipp: Vermeide Ziele, die nicht von dir oder deinem Team selbst beeinflusst werden können.
T – Terminierbar
Das letzte SMARTe Kriterium ist einfach: nenne eine Zeitangabe, bis wann das Ziel erreicht werden soll.
Dieses Kriterium trifft nicht auf alle Ziele zu. Handelt es sich beispielsweise um ein rein finanzielles Ziel wie die Budget-Einhaltung oder ein rein technisches (“dunkelrote Dachziegel”), dann spielt die Terminierbarkeit häufig keine Rolle. Stattdessen werden Terminziele werden häufig separat formuliert.
Müssen immer alle Kriterien der SMART-Formel erfüllt sein?
Klare Antwort: Nein. Nicht jedes Ziel muss alle der Kriterien vollständig erfüllen. Der gesunde Menschenverstand hilft dabei, wenig sinnvolle Kriterien wegzulassen.
Wie oben erwähnt: Nutze SMART als Checkliste und prüfe, ob die Kriterien für dein Ziel sinnvoll sind. Die Erfahrung aus der Praxis zeigt, dass die meisten Ziele zu unkonkret und messbar formuliert werden – hier gibt es meist das größte Potenzial zur Verbesserung.
Beispiele für SMARTe Ziele
| Nicht so gut | Viel besser! |
|---|---|
| Ich will weniger rauchen. | Ab dem 1.5. Rauche ich keine einzige Zigarette mehr – für den Rest meines Lebens. |
| Die Stakeholder sollen informiert werden. | Alle in der Stakeholder-Analyse mit Priorität A gekennzeichneten Stakeholder erhalten jeweils zum Monatsende einen 2-seitigen Statusbericht mit Angaben über Soll- und Ist-Stand des Projektes und aktuelle Aktivitäten per Mail zugesendet. |
| Bessere Nutzerfreundlichkeit | Die Usability der Software wird von mindestens 90 % der Teilnehmer eines Usability-Tests mit „Sehr gut“ bewertet. |
| Umsatzsteigerung | Die Bruttoumsätze in der Produktkategorie „Damenhüte“ steigen im 2. Quartal des Jahres um mindestens 15 % im Vergleich zum Vorjahr. |
| Einhaltung des Kostenrahmens | Das Projektbudget i.H.v. 100.000 Euro wird nicht überschritten. |
Erweiterungen von SMART
Fünf Kriterien für gute Ziele reichen dir nicht? Dann findest du hier Erweiterungen, die in manchen Projekten eingesetzt werden:
- SMARTER: Hier wurden Kriterien wie „Evaluated“ (Evaluiert) und „Reviewed“ (Überprüft) hinzugefügt.
- SMARTTA: „Trackable“ (Nachverfolgbar) und „Agreed“ (Abgestimmt) wurden als zwei Kriterien ergänzt.
- I-SMART: Das vorgesetzte „I“ steht für „Impact“ und damit als übergeordnetes soziales Ziel.
Damit nicht genug: Angelehnt an SMART existieren weitere Akronyme, die ebenfalls zur Zielformulierung eingesetzt werden können:
Weiterlesen: PURE, CLEAR, PIDEWaWa, AMORE und MAGIE: Die unbekannten Geschwister der SMART-Formel
Kritik an der SMART-Formel
Du hast es sicher in den vorigen Abschnitten bereits gemerkt: SMART kann unterschiedlich eingesetzt werden:
- Welche Buchstaben sollst du überhaupt nutzen?
- Welche Bedeutungen haben sie?
- Und wäre eine Erweiterung oder ein anderes Akronym nicht noch besser geeignet?
Fragen wie diese führen schnell dazu, SMART als schwammige Methode anzusehen, die zu Missverständnissen führt, weil jeder sie anders interpretiert. Auch hier gilt: Sieh SMART nicht als feste Regel, sondern als ein einfaches Hilfsmittel und als Checkliste, um bessere Ziele zu formulieren. Falls du Missverständnisse vermeiden möchtest, kannst du die Bedeutung der Buchstaben in deinem Projekt konkret festlegen.
Eine weitere Kritik bezieht sich auf langfristige und strategische Ziele. Besonders bei der Formulierung visionärer Ideen ist es schwierig, eine Messbarkeit oder ein Zieldatum festzulegen. Und müssen solche Ideen immer realistisch sein? Manchmal bringen die verrückten, beinahe wahnsinnig wirkenden Ideen den größten Effekt – allein durch ihre Motivationswirkung. Reden wir allerdings über Projektziele, sind spezifische, messbare und realistische Ziele in den meisten Fällen angemessener.
Fazit
SMART-Ziele sind weit mehr als ein „alter Hut“ – sie sind ein bewährtes Werkzeug, um konkrete Ziele sauber zu formulieren. Ob qualitativ (z. B. bessere Kundenzufriedenheit) oder quantitativ (z. B. mehr Umsatz): Klare Zieldefinitionen helfen, das Ziel zu erreichen, ohne dass schwammige Formulierungen am Ende demotivierend wirken.
Besonders in Zielvereinbarungen ist es wichtig, dass Ziele verbindlich formuliert sind, eine klare Terminierung haben und für alle nachvollziehbar bleiben. Denn am Ende gilt: Ziele sollten so klar formuliert sein, dass sie Orientierung geben und nicht für Missverständnisse sorgen.
Fragen und Antworten
Der Begriff ist ein Akronym: SMART steht für spezifisch, messbar, akzeptiert, realistisch und terminiert. Je nach Quelle werden die Buchstaben auch etwas anders interpretiert – entscheidend ist, dass die SMART-Methode dir hilft, klare Ziele zu formulieren.
Weil SMART Klarheit schafft: Vage Wünsche werden in konkrete Ziele übersetzt, die messbar und nachvollziehbar sind. Das gilt für qualitative Ziele wie „Mitarbeiterzufriedenheit steigern“ ebenso wie für quantitative Ziele wie „15 % Umsatzsteigerung“.
Nein, nicht zwangsläufig. Die SMART-Formel ist eher eine Checkliste, mit der du deine Formulierung hin überprüfen kannst. Ziele müssen spezifisch sein, doch ob zum Beispiel eine exakte Terminierung sinnvoll ist, hängt stark von Kontext, Stärken und Schwächen des Projekts und vom Zeithorizont ab.
Ja, allerdings ist es bei langfristigen Zielen oft schwieriger, alles konkret zu formulieren. Managementforscher und Unternehmensberater empfehlen in solchen Fällen, Meilensteine oder Teilziele zu setzen. So bleibt das „große Ganze“ ambitioniert und womöglich etwas offen, die Zwischenziele aber konkret und nachvollziehbar.
Ganz einfach: Geh die Kriterien der SMART-Methode noch einmal durch und frage dich, ob alles erfüllt ist. Ein praktisches Vorgehen ist, die Zielformulierung einmal dem Team oder einem Kollegen vorzulegen. Oft wird dabei schnell klar, ob etwas noch zu vage ist.





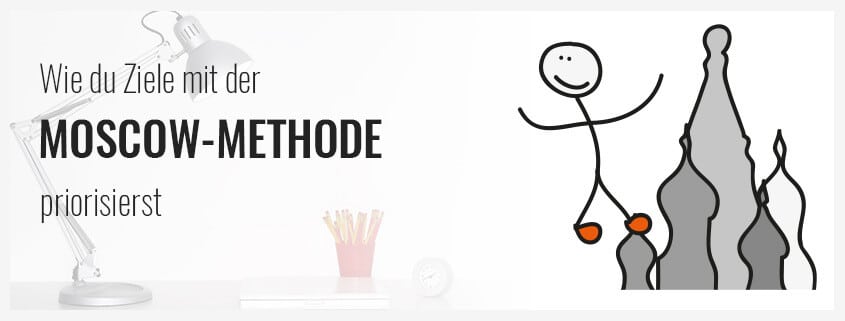

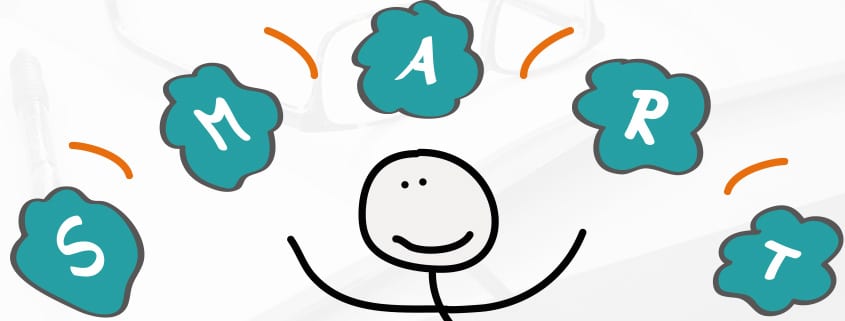



Tolles Beispiel zur SMART Metode. Danke. Und wenn man sich mal wieder verzettelt, kann auch hier Software sehr hilfreich sein. http://quomod.com/smart-und-die-macht-der-eingabefelder/
Sehr interessanter Beitrag über´s Ziele setzen und erreichen. Auch ich habe einen Beitrag dazu verfasst aber mir gefällt deiner mehr. Ich werde mal wieder vorbeischauen.
Dein Sascha von http://www.sh-lifestylecoaching.com/
Sascha
Volter15@web.de
Hallo ihr,
ich hab ein Problem bei der Zielformulierung für einen meiner Patienten. Er hat Parkinson und ich möchte für ihn ein Ziel zur Haltungsstörung, zum Gleichgewichtstraining, zum Hilfsmitteltraining, Atem und Kraft schreiben. Könntet ihr mir dabei helfen?
Lieben Dank!
Hui … das ist nicht gerade unser Spezialgebiet! Trotzdem folgende Anmerkungen: Wichtig ist immer die Messbarkeit, am besten konkrete Zahlen. In dem genannten Beispiel könnte ich mir vorstellen, dass der Patient eine Übung für eine bestimmte Anzahl von Sekunden halten soll. Oder eine bestimmte Anzahl von Wiederholungen nötig ist. Auch beim Thema Atem kann man über die Zeit gehen, z.B. x Sekunden ein- und y Sekunden ausatmen. Kraft: 10 Wiederholungen mit 2 Kilogramm 5x pro Woche? Du siehst … auch auf diesem Gebiet kann man messbare Kriterien festlegen. Ich hoffe, das hat ein wenig geholfen!
Toll, grundsätzlich gebe ich der Autorin bis auf einen Punkt recht. Man definiert grundsätzlich in einer SMART Analyse NIE und NIMMER das Budget, weil das Budget schon festgelegt wurde und es eine Selbstverständlichkeit ist, dass es eingehalten wird. Wenn es überschritten wurde, dann muss das Budget angepasst werden. Alles was zum Projekt schon vorgegeben wird, wo SMART Ziele nötig sind, werden nicht formuliert. Nur das Ziel, welches unbedingt MESSBAR sein muss, ist ein wichtiger Kernfaktor und eigentlich die Hauptursache für das nicht gelingen des Ziels, wie die Autorin es hervorragend geschildert hat.
Hallo,
vielen Dank für die Anregung! Bei vielen Projekten sehe ich das ebenso: Es gibt ein vorgegebenes Budget, in der SMART-Analyse werden anschließend messbare Kriterien für die Projektinhalte festgelegt.
Ich habe aber auch schon Projekte erlebt, in denen eine Zielanalyse sehr früh vorgenommen wurde. In diesen Fällen wurde das Budget erst danach beantragt – stand also nicht schon fest. In diesem Fall war es durchaus sinnvoll, das Budget in die Zielformulierung aufzunehmen, unter anderem als Argumentationshilfe. Aber hier unterscheiden sich die Fälle sicher, sodass es keine ultimative Universalantwort gibt :-) Viele Grüße, Andrea
Die SMART-Formel wird immer wieder in allen möglichen und unmöglichen Definitionen weitergegeben. Das ist so ärgerlich, dass ich sie in meinem Buch „Organisation“ wieder herausnehmen werde. Es gibt auch keine zitierfähige Originalquelle, jeder erzählt was er will. In der mir bekannten englischen Originalformel bedeutet SMART: Specific, Measurable, Attainable (erreichbar), Relevant und Time-Bound. – Noch viel Spass im Begrifswirrwarr. – Man sollte nur noch Quellen verwenden, die auch zitierbar sind.
Hallo Adrian, vielen Dank für deinen Kommentar! Klar … das kann frustrieren, wenn man eine absolut eindeutige Definition sucht. Wie viele andere Methoden ist die SMART-Formel nicht wissenschaftlich untermauert, sondern ist in der Praxis entstanden. Kein Wunder, dass es unterschiedliche Auslegungen gibt! Am wichtigsten ist doch, dass sie in der täglichen Arbeit hilft.