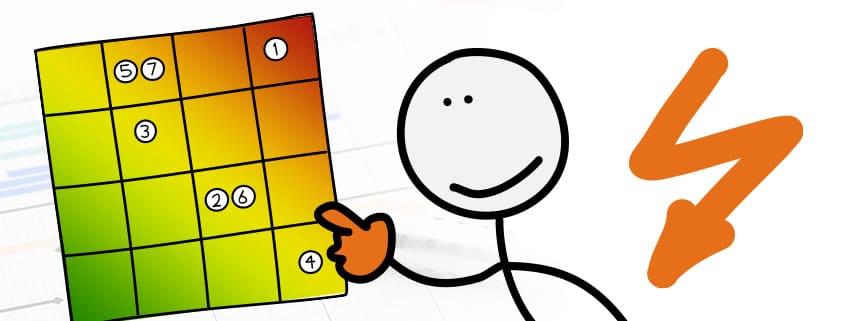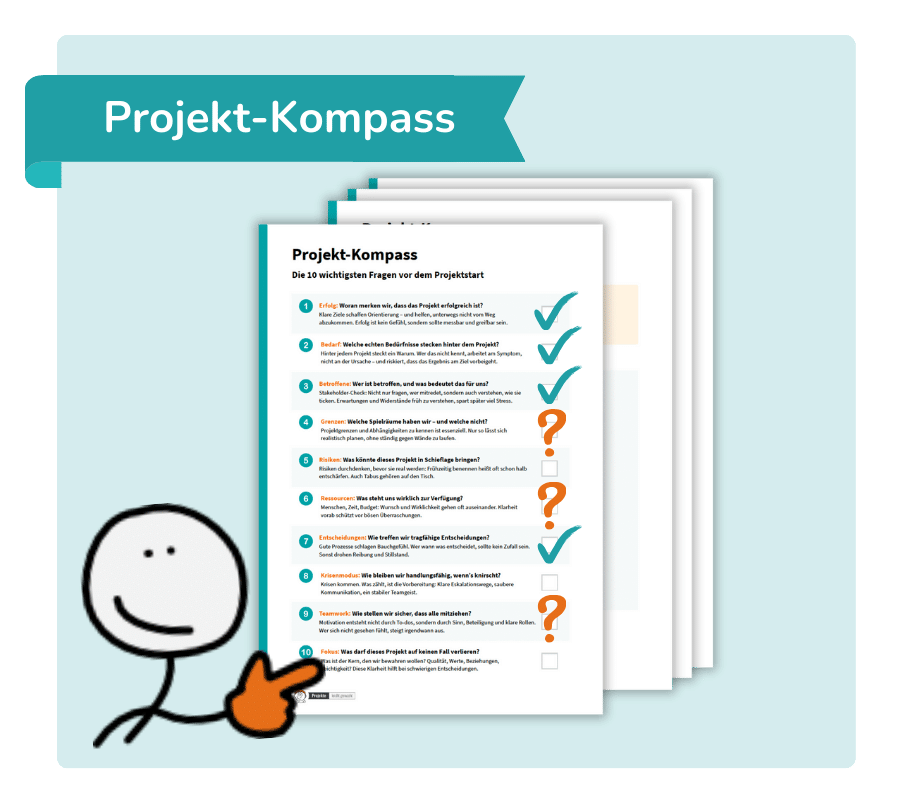Für Eilige: Alles Wichtige auf einen Blick
Artikel-Highlights
„Mortem“ – hat das nicht was mit dem Tod zu tun? Jawohl, damit liegst du gar nicht so falsch! Beim Pre-Mortem versetzen wir uns gedanklich in eine Zukunft, in der dein Projekt spektakulär gegen die Wand gefahren ist, und fragen uns dann ganz entspannt: „Okay … was ist passiert?“ Warum das so gut funktioniert und wie du damit dein Projekt damit „vor dem Sterben rettest“, erfährst du in diesem Artikel.
Was ist Pre-Mortem?
Pre-Mortem auch: (Premortem) ist eine Methode, bei der du dein Projekt gedanklich schon scheitern lässt, bevor es überhaupt richtig losgeht. Der Ansatz kommt ursprünglich aus der strategischen Planung und wurde unter anderem durch den Organisationspsychologen Gary Klein bekannt gemacht.
Stell dir Pre-Mortem wie eine „vorausschauende Rückschau“ vor: Versetze dich in eine Zukunft, in der das Projekt bereits krachend gescheitert ist. Die Frage lautet dann nicht „Was könnte passieren?“, sondern: „Was ist passiert?“
Nicht: Was könnte etwas schiefgehen, sondern: Es ist bereits schiefgegangen.
Unterschiede zu Post-mortem und Risikoanalyse
So unterscheidet sich Pre-Mortem von ähnlichen Methoden:
- Ein Post-Mortem findet nach einem Projekt statt, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Das ist zwar wertvoll für zukünftige Projekte, hilft aber dem aktuellen „toten“ Projekt nicht weiter. Beim Pre-Mortem drehst du den Spieß um: Du nutzt die Idee der „Nachbetrachtung“, bevor überhaupt etwas passiert ist und kannst dadurch rechtzeitig gegensteuern.
- Eine klassische Risikoanalyse versucht systematisch, potenzielle Gefahren zu identifizieren. Sie ist wichtig und sinnvoll, bewegt sich aber oft in bekannten Kategorien und typischen Checklisten. Ein Pre-Mortem erweitert die Perspektive und ermuntert auch unkonventionelle Gedanken.
Vorteile: Warum sich ein Pre-Mortem lohnt
Anders als klassische „Was könnte passieren?“-Runden holt Pre-Mortem Dinge ans Licht, die im Alltag gern untergehen oder unausgesprochen bleiben. Warum das so gut funktioniert:
- Es durchbricht Gruppendenken / Group Think: Wenn alle so tun müssen, als wäre das Scheitern schon passiert, fällt die Angst weg, Bedenken zu äußern oder „negativ“ zu wirken.
- Es stoppt Überoptimismus: Beim Projektstart sind Teams oft euphorisch, sodass Risiken gern mal unter den Tisch fallen. Mit Pre-Mortem wird bewusst die Perspektive gewechselt. Selbst „Positiv-Denker“ haben oft Spaß daran, eine potenzielle „Projektleiche“ zu obduzieren!
- Es macht blinde Flecken sichtbar: Die Frage „Was ist schiefgegangen?“ öffnet den Blick für Situationen, die in einer klassischen Risikoanalyse schnell vergessen werden.
- Es schafft Lockerheit: Die hypothetische „Projektleiche“ erlaubt Humor, Offenheit und ungewöhnliche Gedanken. Es kann Spaß machen, ganz ohne Druck über Katastrophen nachzudenken!
- Es führt schneller zu konkreten Maßnahmen: Wenn ein Risiko als „passiert“ beschrieben wird, wird die Dringlichkeit plötzlich klarer als beim „könnte irgendwann passieren“.
Kurz gesagt: Ein Pre-Mortem kann dir beim Identifizieren von Risiken helfen, die du sonst nie entdeckt hättest.
So führst du ein Pre-Mortem durch
Ein Pre-Mortem klingt kompliziert, ist aber nichts anderes als ein strukturierter Workshop. Du brauchst lediglich ein Team mit der Bereitschaft, euer Projekt mal eben sterben zu lassen. So solltest du den Workshop vorbereiten:
- Der richtige Zeitpunkt: Starte, sobald euer Projekt grob definiert ist, also bevor die Planung in Stein gemeißelt ist.
- Die richtigen Leute: Lade das Kernteam, wichtige Stakeholder und gern auch 1–2 Personen „von außen“ ein, die frische Perspektiven mitbringen.
- Das richtige Mindset: Kündige schon vorher eine gewisser Lockerheit an: „Willkommen zur „Projektobduktion!“ Statt „Lass uns eine Risikoanalyse durchführen.“
So kann der Workshop konkret ablaufen. Passe Details an dein Projekt an!
| Schritt | Was passiert? | Worauf achten? |
|---|---|---|
| 1. Szenario festlegen | Du eröffnest mit: „Stellt euch vor, das Projekt ist gescheitert. Was könnte passiert sein?“ | Locker formulieren, Druck rausnehmen, Humor ist ausdrücklich erlaubt. |
| 2. Einzelarbeit | Jede Person notiert mögliche „Todesursachen“. Erlaube alles, was schiefgegangen sein könnte. | Ermuntern, auch ungewöhnliche oder kleine Punkte zuzulassen. |
| 3. Sammeln und Clustern | Alle Beiträge werden sichtbar gesammelt und thematisch gruppiert. | Themen bündeln (zum Beispiel Organisation, Kommunikation, Technik …). |
| 4. Priorisieren | Das Team bewertet: Was wäre besonders kritisch? Was wahrscheinlich? | Fokus auf die 3–5 wichtigsten Risiko-Themen legen. |
| 5. Maßnahmen ableiten | Zu jedem Top-Risiko konkrete Schritte und Verantwortlichkeiten definieren. | Ohne klare Zuständigkeit wird nichts passieren – Verantwortliche festlegen! |
| 6. Dokumentieren | Ergebnisse fließen in Risikoliste, Maßnahmenplan und Projektsteuerung ein. | Sicherstellen, dass nichts verschwindet. Follow-up einplanen! |
Pre-Mortem: Ein Beispiel
Häufige Fehler und wie du sie vermeidest
Ein Pre-Mortem ist einfach umzusetzen, scheitert aber oft an ein paar typischen Stolperfallen. Die gute Nachricht: Wenn du sie kennst, kannst du sie ziemlich leicht umgehen.
- Timing zu spät: Viele Teams führe ein Pre-Mortem erst durch, wenn die Projektplanung schon abgeschlossen ist. Dann bleibt kaum noch Spielraum, Maßnahmen einzuplanen und umzusetzen. Besser: Startet früh, sobald das Projekt grob umrissen ist.
- Zu kleine oder zu homogene Runde: Wenn nur das Kernteam dabei ist, kommen oft dieselben Denkweisen zusammen. Besser: Nehmt 1–2 Personen dazu, die nicht tief im Projekt stecken, aber mitdenken können. Frische Perspektiven wirken oft Wunder!
- Fehlende psychologische Sicherheit: Wenn die Atmosphäre steif ist oder einzelne Personen Angst haben, „kritisch“ zu wirken, bleiben die wichtigsten Risiken unausgesprochen. Besser: Ermutige zu Humor und betone, dass es nicht um Schuld geht. Wenn sich alle trauen, „blöde“ Ideen zu nennen, dann wird es richtig wertvoll.
- Endlose Diskussionen: Manche Teams verzetteln sich in Debatten über Details und verlieren den Fokus. Besser: Erst sammeln, dann clustern, dann priorisieren. Hier ist gute Moderation gefragt!
- Keine Maßnahmen ableiten: Der größte Klassiker: Alle haben tolle Ideen, aber niemand übernimmt etwas. Das Pre-Mortem endet als „spannender Workshop“, ohne dass danach etwas passiert. Besser: Für jedes Top-Risiko eine konkrete Maßnahme, klare Verantwortlichkeit und einen Termin festlegen.
Kurz gesagt: Ein gutes Pre-Mortem lebt von Offenheit, Tempo und Konsequenz. Wenn du diese klassischen Fehler vermeidest, wird es zu einem der effektivsten Werkzeuge, die du im Projektstart nutzen kannst.
Fazit
Ein Pre-Mortem ist sicher keine Revolution im Risikomanagement, sondern eine hilfreiche Ergänzung zum Sammeln von Risiken: Es nutzt einen anderen Blickwinkel, um auf neue Ideen zu kommen – nicht mehr und auch nicht weniger. Die eigentliche Arbeit danach bleibt dieselbe: Risiken bewerten, priorisieren, Maßnahmen ableiten und sauber nachverfolgen.
Der Vorteil liegt in der Perspektive: Durch das gedankliche „Es ist schon passiert“ entsteht Raum für andere und teils abwegige Gedanken. Für eingespielte Teams, die stark in ihren Denkmustern feststecken, kann genau das ein wertvoller Impuls sein, um die Überlebenschance für dein Projekt steigern.